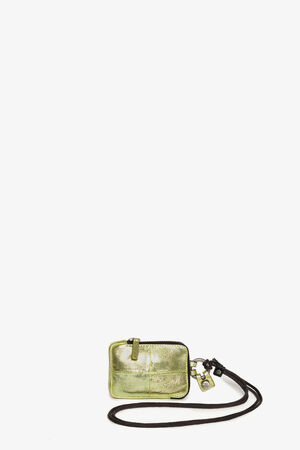Die gesellschaftliche Rolle der Frauen und Mütter und auch die Familienbilder per se haben sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten entscheidend verändert. Hermine und Susanne – welchen Herausforderungen seid Ihr als Mütter und Frauen begegnet – einerseits in den 1960er-Jahren bzw. Ende der 90er-Jahre? Wo lagen die maßgeblichsten Unterschiede im Aufwachsen bzw. der Erziehung von Susanne und dem Aufwachsen von Victoria?
H: Das mag banal klingen, aber rückblickend war es wohl die größte Herausforderung, keine Waschmaschine zu haben – die größte Erfindung der Menschheit ist wahrscheinlich die Waschmaschine! Was das Muttersein per se betrifft … ich hab‘ über die Schwierigkeiten damals gar nicht so sehr nachgedacht. Man könnte sagen, ich hab‘ mich einfach entschieden, immer für meine Kinder da zu sein. Mir war wichtig, dass meine Töchter eine gute Schulausbildung erhalten, dass sie in die Welt hinausgehen und lernen, offen zu sein – ich denke, das ist vielleicht eine Form der Weltanschauung, die in den 1960er- und 1970er-Jahren nicht der Regel entsprach. Aber ich hab‘ das damals gar nicht als so besonders modern empfunden, es hat sich für mich einfach richtig angefühlt und ich hab‘ alles unternommen, um ihnen das zu ermöglichen.
S: Ich muss sagen, ich hab‘ mir nie überlegt, was es gesellschaftlich tatsächlich bedeutet, Mutter zu sein, weil ich mich von der Gesellschaft auch nie so unter Druck gesetzt fühlte. Ich hab‘ immer das gemacht, was mir mein Bauchgefühl gesagt hat und es hat sich gezeigt, dass ich mich darauf verlassen kann. So, wie ich selbst aufgewachsen bin, hat mich dabei natürlich immens geprägt. Dass ich schon im jungen Alter viel ausprobieren durfte und verreisen durfte – ich war bereits im jungen Alter z. B. in Kanada und Lateinamerika – hat natürlich Spuren hinterlassen. Es ist großartig, dass ich das erleben durfte … dadurch hatte ich nie das Gefühl, etwas versäumt zu haben. Man kann sagen, meine Töchter haben auch davon profitiert. So, wie ich aufgewachsen bin, das hab‘ ich auch meinen Kindern weitergegeben. In der Erziehung meiner Kinder achtete ich darauf, keine Tabus zu etablieren. Ich hab‘ meine Kinder immer als Gleichgesinnte behandelt … sie waren überall dabei und sind nicht abseits am Kindertisch gesessen, um das Kindermenü zu essen. Und natürlich hatten meine Töchter es insofern gut, als sie auch alles ausprobieren durften. Sie mussten nichts machen, aber sie durften alles machen. Wobei … sie wollten dennoch immer mehr machen, als ich erlauben wollte, aber sie haben sich immer durchgesetzt.
Was die Kinderbetreuung betrifft, erfüllt der Staat seine Rolle nicht so, wie er sollte. In Bezug auf Verteilungsgerechtigkeit gibt es nach wie vor sehr viel Luft nach oben. Was sich glücklicherweise geändert hat, ist, dass es nun ein einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bzw. Karenzgeld gibt. Heute ist es selbstverständlich, dass man während der Karenzzeit 80 % des letzten Einkommens weiterbezieht. In den 90er-Jahren war das noch nicht so. Ich empfand das als so ungerecht … ich habe immer gut verdient und hab‘ nicht eingesehen, dass von mir erwartet wird, während der Karenzzeit mit 4000 Schilling auszukommen. Damals habe ich sogar Briefe ans Ministerium geschrieben … geändert wurde das System erst dann, als es plötzlich relevant wurde, die Männer mit ins Boot zu holen, damit auch diese in Karenz gehen können. Ein Mann wäre niemals für 4000 Schilling zu Hause geblieben. Aber manche Dinge brauchen eben Zeit – vor 10 Jahren war es auch unvorstellbar, innerstädtische 30er-Zonen zu errichten. Und, dass man nicht mehr 50 Kilometer zum nächsten Bio-Bauern fahren muss, um biologische Lebensmittel zu bekommen, das ist auch ein Segen.